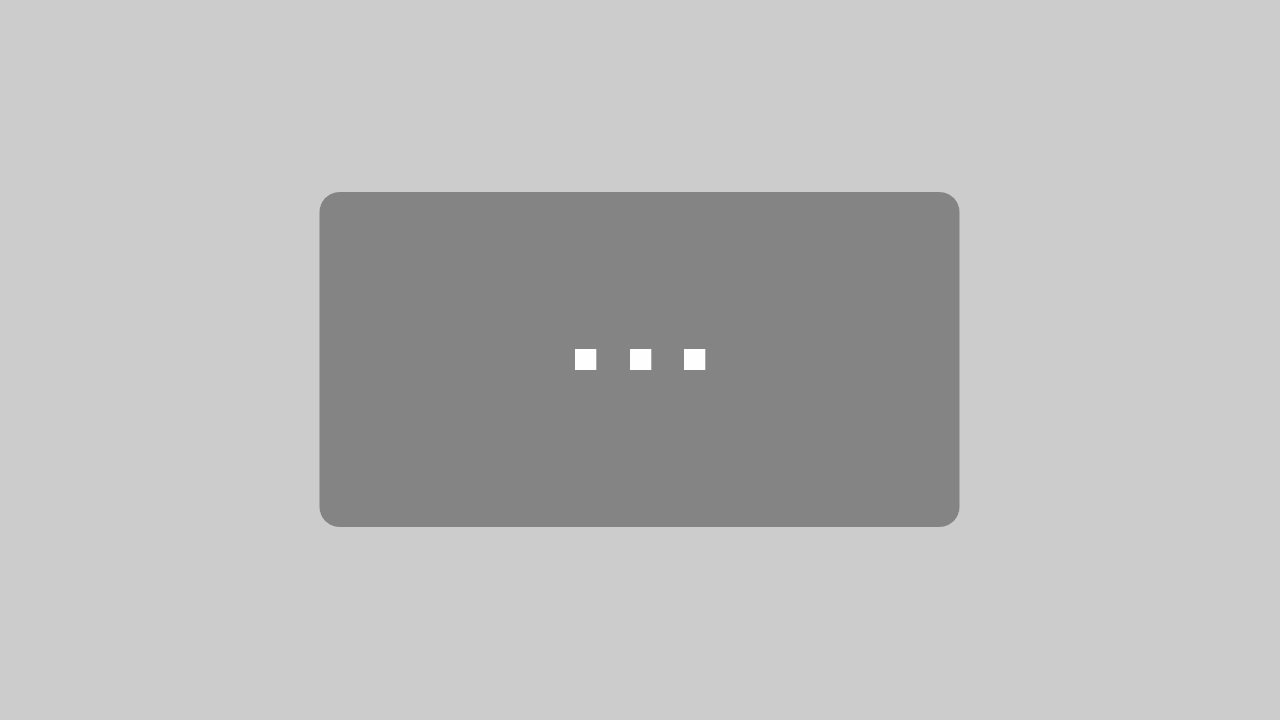Ich bin ein 90s-Kid. Tic Tac Toe, die Spice Girls und Destiny’s Child waren mein Soundtrack – Girlpower pur. Ich find’ dich scheiße war damals nicht nur ein Song, sondern eine Ansage. Schon da haben Frauen gezeigt, dass sie nicht leise sein müssen. Was damals als frech galt, ist heute weiterentwickelt: FLINTA-Künstler*innen reclaimen Begriffe, brechen Tabus und machen daraus eine Kunstform, die nicht nur provoziert, sondern auch empowernd wirkt.
Auch heute gibt es Momente, in denen mich Musik eiskalt erwischt. Nicht, weil sie besonders schön klingt oder tiefgründig ist, sondern weil sie mir eine knallt. Genau so ging es mir, als ich zum ersten Mal FLINTA*-Künstler*innen wie SXTN, Mariybu oder Peaches hörte, die mit einer Selbstverständlichkeit Begriffe wie Schlampe und Bitch in ihre Texte packten.
Ich habe mich gefragt: „Muss das wirklich sein?“ Und noch mehr: „Ist das der richtige Weg?“ Aber je mehr ich mich mit der Musik und den Künstler*innen auseinandergesetzt habe, desto mehr wurde mir klar: Das ist genau der Punkt. Es geht nicht darum, höflich zu sein. Es geht darum, laut zu sein, Grenzen zu verschieben und das Establishment so sehr zu provozieren, dass es ins Schwitzen gerät.
Und das gefällt nicht jedem. Ich höre oft Kommentare wie: „Muss das so vulgär sein?“ oder „Das ist doch nur provokant, damit man drüber redet.“ Und ja, genau das ist der Punkt: Man muss darüber reden.
Worte entwaffnen: Reclaiming in der Musik
Reclaiming – das Zurückerobern von Worten – war mir schon aus der queeren Szene bekannt. Dort werden Begriffe wie queer, schwul oder Dyke, die lange als Beleidigung galten, stolz getragen, um ihre Macht als Waffe zu brechen. Doch als ich merkte, wie FLINTA*-Künstler*innen dieses Prinzip in der Musik nutzen, war ich erst skeptisch. Kann das funktionieren?
Und wie das funktioniert! Wenn Frauen Begriffe wie Schlampe oder Bitch reclaimen, nehmen sie den Männern das Monopol auf ihre Sprache. Sie scheinen zu sagen: „Ihr habt uns mit diesen Worten verletzt, aber jetzt gehören sie uns. Und wir tragen sie wie ein verdammtes Diadem.“
Für manche Menschen ist das schwer zu verstehen. Sie hören diese Texte und fühlen sich direkt angegriffen oder abgestoßen. Ich frage mich: Ist das ein Generationsding? Ist das ein Szeneding? Ist das Gefühl, dass Sprache provokant und unangemessen ist, etwas, das mit den Jahren kommt? Oder ist es einfach die Macht der Gewohnheit, die uns Dinge akzeptieren lässt, solange sie nicht zu sehr aus der Norm ausbrechen?
Von SXTN zu Juju: Pöbeln mit Haltung
Ein Paradebeispiel dafür ist SXTN, das Duo, das ich anfangs als frech, rotzig und ein bisschen zu laut empfand. Ihre Texte wie Von Party zu Party oder F*tzen im Club provozierten mich – und genau das war der Punkt. Juju und Nura haben Begriffe und Themen genommen, die Frauen sonst kleinmachen sollten, und sie mit einer solchen Kraft zurückgeworfen, dass ich dachte: „Wow, das sitzt!“
Ich gebe zu, dass ich anfangs auch dachte: „Ist das nicht ein bisschen zu viel?“ Aber genau das ist der Punkt: Sie wollten nicht, dass es allen gefällt. Juju hat diesen Stil auch solo beibehalten. Mit Tracks wie „Hardcore High“ reclaimt sie Begriffe und erzählt Geschichten, die unbequem sind – aber verdammt wichtig.
I am raw html block.